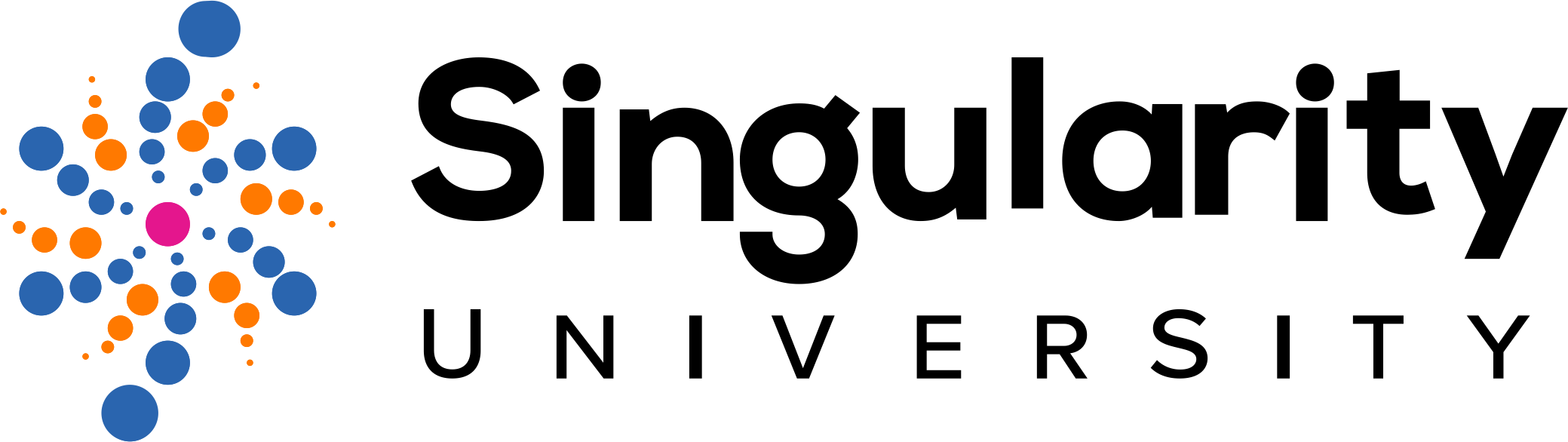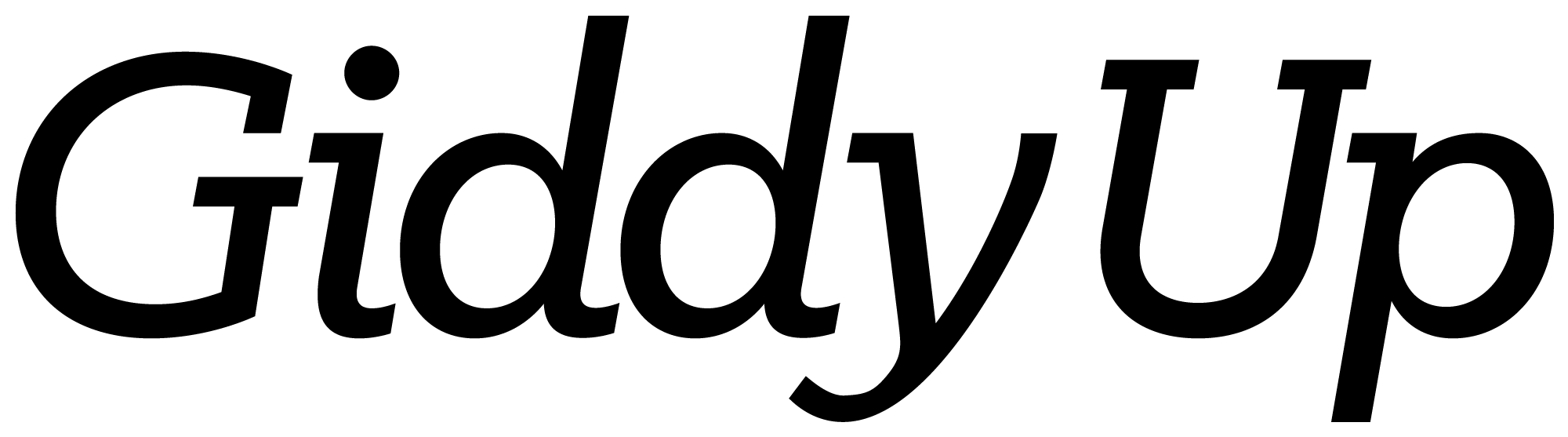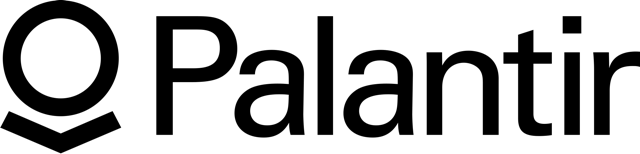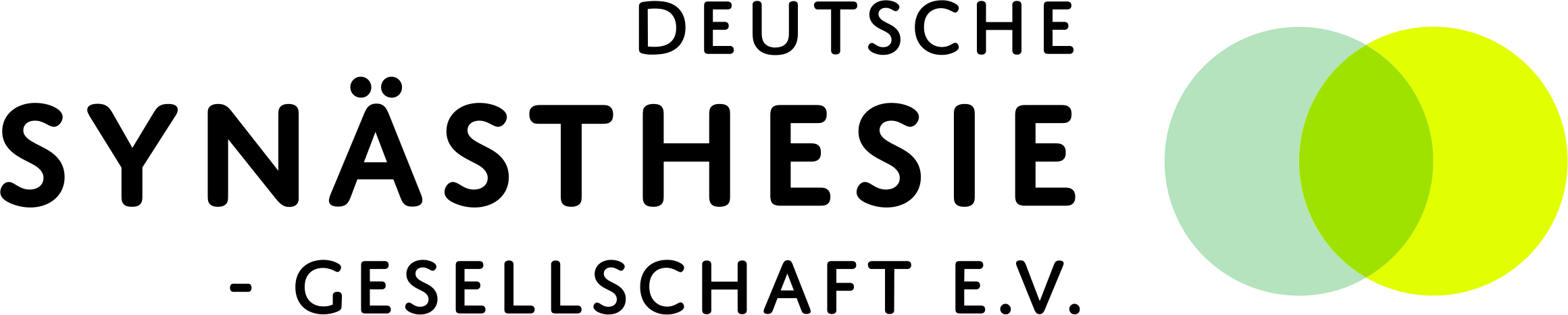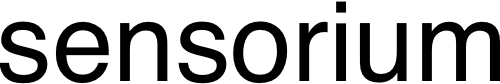1 So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder 2 und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. 3 Von Unzucht aber und jeder Art
Weibliche Intuition
ist Evolution
ist Entwicklung
Der Verstand
Die Eigenschaft
Die Provokation
An die Freude
und die Freunde
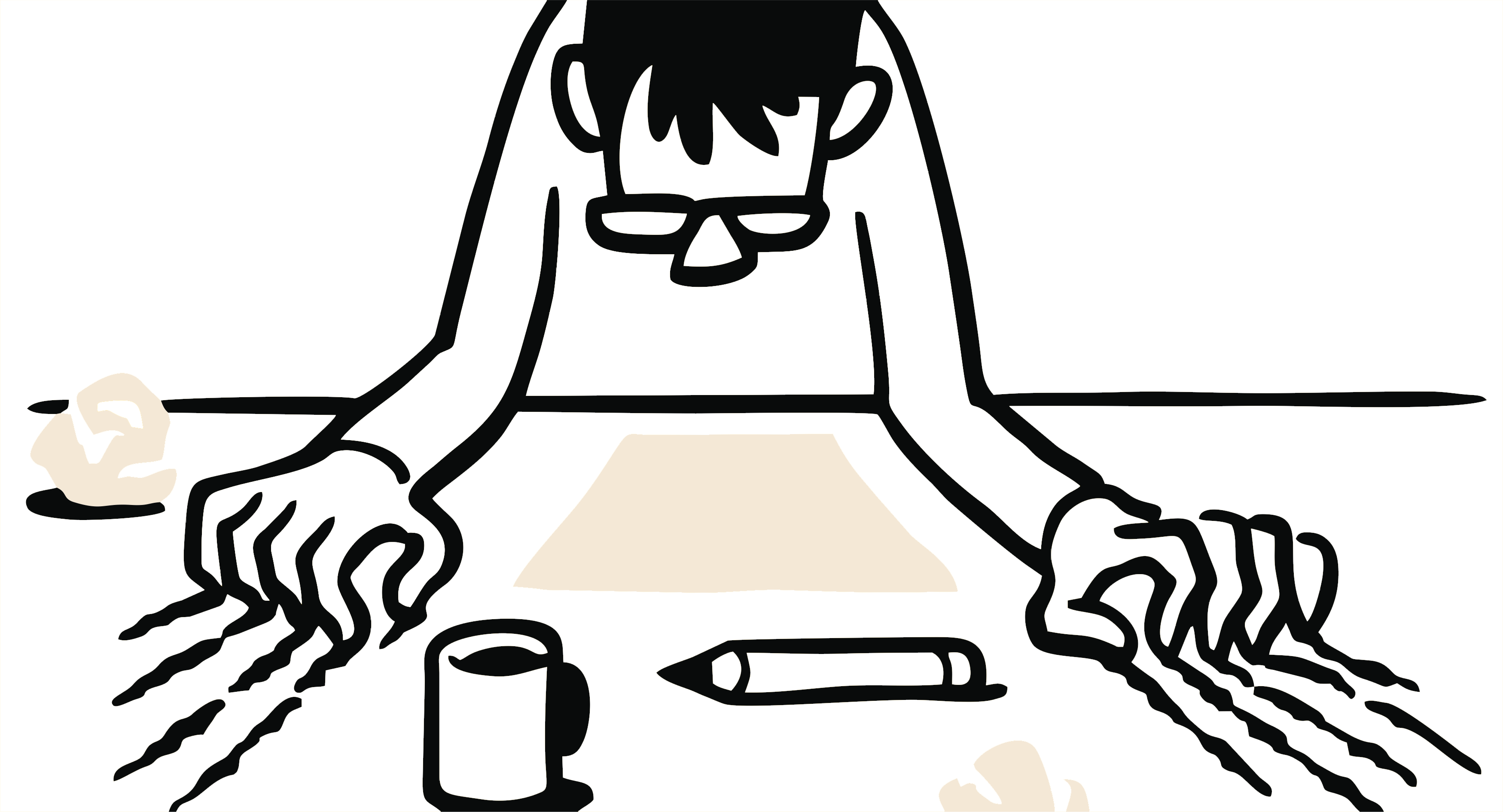
Mission
Wir sind eine Gruppe berufener Unternehmer.
Macher. Anders. Rebellen. Und ein ganz Verrückter mitten drin.
Wir leisten Enormes für die Sache. Das Ergebnis. Nicht folgsam. Dennoch strebend.
Wir prüfen das „WHY“ – und arbeiten nicht für jeden oder jeden Preis.
Wir arbeiten gerne und hart. Ergebnisse bereiten uns Freude. Die Ode.
Wir haben im Laufe unseres Lebens rund 1.000 Arbeitsplätze geschaffen, über 500 Kunden erfolgreich digital begleitet – und stets unsere Steuern bezahlt!
Wir bieten ungewöhnliche Lösungen für gewöhnliche Herausforderungen.
Wir sind keine Agentur, sondern Vollständig.
Der Mensch ist
das einzige Wesen,
das im fliegen
eine warme Mahlzeit
zu sich nehmen kann.
DER VERSTAND
DIE EIGENSCHAFT
DIE PROVOKATION
ODE AN DIE FREUDE
GEFÜHL IST NICHT
VERSTAND, VERSTAND
IST KEIN VERGNÜGEN,
UND VERGNÜGEN IST
gewiss kein Verstand.
Wenn ich sage,
das Surfen ist
hier sicher,
ist es hier sicher.
Statements #1
Statements
Die Steigerung von Empathie ist Synästhesie.
Der von den Nachkriegs-Fleissigen geerbte Überfluss führte zum Achtsamkeitsverlust.
Echte Talente werden nie gefördert – aus Angst der Beschenkten, Mutlosen und Neider.
Genormte schützen sich durch Normen.
Gute Software fördert Werkstoff- und Gesundheits-Forschung, senkt Energie- und Klima-Risiken – und beschleunigt Firmen, wenn mans kann. Und will.
Die Trennung ist des Kreativen Freund.
Die Sicherste aller je erlebten Zeiten spaltet den Wissens-Durst. Die Hungrigen nutzen das freie Wissen.
KI ist gut – in redlicher Hand.
In der Wissens-Gesellschaft hilft nicht die DSGVO, sondern das Bewusstsein zur eigenen Verantwortung der selbst gewollten Identität. Die Technik ist seit 20 Jahren da. Könnt Ihr aber auch lassen. Ist ja alles reguliert.
Die Geschwindigkeit der Veränderung, also der grösste „Human-Shift ever“ steigt exponentiell. keep it – or leave it.
Statements #2
Only interests and willing in understanding the actual complexity will thrive the way to the simpliest and fastest solution in the ever-best quality. Surrender and hard work is the key.
Slowness Accelerate.
Wer mit geliehener Macht und geliehenem Geld in die Überzeugungsfalle tappt – wird gefährlich.
Assesments durch Personalvermittler oder HR- Abteilungen sind mittelalterliche Verhöre, also Anzeichen erhöhter Angst vor Talenten.
Wer ein Startup-Up ohne Gier aufbaut, wird tatsächlich nachhaltig Gewinne erwirtschaften.
1.000 Mitarbeiter in 12 Monaten nachhaltig einstellen klappt nur noch bei voller Digitalisierung.
Wer Delegiertes vorher nicht selber beherrschte, wird scheitern.
Wer (als Hersteller) immer noch proprietäre Schnittstellen durchsetzen will, wird wenig Erfolg haben.
Pioniere im Alten: Reisen und Entdecken.
Pioniere im Neuen: Denken und Verstehen – digitalisiert.
INTUITION IST
INTELLIGENZ MIT
ÜBERHÖHTER
GESCHWINDIGKEIT.
Partner
Angebot
Im Kontext der Digitalisierung lösen wir konkret und ohne PowerPoint-Schlacht folgende Aufgabenstellungen:
- Ausrichtung Deiner IT aus Sicht der Kunden und Märkte
- Analyse Deiner Unternehmens-Kultur und Lösungs-Vorschläge für Transformationen
- Entwicklung komplexer Cloud-Architekturen für neue Services in Deinem Unternehmen
- Nachhaltige Cyber-Security-Konzepte (Nutzer-zentrische Corporate-Compliance)
- Coaching Deiner Führungskräfte zur Bewältigung der Digitalisierung
- Geschäftsmodell-Entwicklung im Design-Thinking und Markt-Kommunikation dazu
- Krisen- und De-Eskalations- Management
- Insolvenz-Management, Sanierung und Neu-Ausrichtung
Dass wir das können, müssen wir nicht mehr beweisen.
Wir arbeiten 100 % digital – selbst ohne Präsenz-Meetings erzielen wir die Ergebnisse.
Natürlich wollen wir Dich auch persönlich kennen lernen – oder Du uns?
Blog & Lyrics
Epheser 5
Weiterlesen »
Führung & Vertrauen Weiterlesen »
Ein wesentlicher Faktor im Tenor der Beschleunigung ist Vertrauen – in beide Richtungen. Das spart Kontrollen, Rückfragen, Mails mit zu vielen Teilnehmern und zehrende Meetings. Als Führungskraft hast Du zudem noch die Herausforderung des Zutrauens. Wie also merkst Du, dass Du jemanden
Cloud-Power Weiterlesen »
Die Ära des „Cloud-Computing“ begann im Grunde schon mit großen Rechenzentren innerhalb großer Strukturen und ihrer (privaten) Weitverkehrsnetze. Das waren Konzerne, Regierungen oder Institutionen wie z.B. die Datev. Im 20. Jahrhundert war das als Internet bekannte Netz nicht unbedingt zuverlässig genug und vor
Sustainability Weiterlesen »
Neudeutsch: Nachhaltigkeit. Greta ist durchaus mutig und kämpft wohl mehr mit ihrer erhöhten Wahrnehmung (Ärzte nennen das ja „Krank“) und ihren überforderten Eltern sowie deren Bedarf an Einkunft. Natürlich liegt sie nicht immer richtig. Sie ist ja auch sehr jung. Aber
Liebe, Beziehung und Missverständnisse Weiterlesen »
Zu Recht stellt Ihr Euch die Frage, was Liebe mit Beschleunigung von Unternehmen zu tun hat. Richtig – erst mal nichts in einer Meeting- und Protokoll- getriebenen Struktur. Es geht auch nicht um die vielbeschworene Leidenschaft, mit der man leisten soll,
Prozesse, Service und Kunden Weiterlesen »
Unternehmensberatungen haben seit vielen Jahren goldene Zeiten. Sie verkaufen „Prozess-Optimierung“. Die senkt Kosten wie durch ein Wunder und wenn nicht – auch egal. Dann war es eine unvorhersehbare Markt-Imponderabilie. Im Grunde verkaufen Berater geklautes Wissen, was sie vorher bei anderen Unternehmen –
Lernen Weiterlesen »
In der Schule oder dem Studium lernen wir vor allem das Lernen. Manche mehr. Manche weniger. Dann richtet ein jeder über die Jahre sein Leben ein. Hier schrieb übrigens schon Seneca, dass das recht lange dauert, also am Ende die Zeit
Meine Heizung und die Co2 – Debatte ... Weiterlesen »
Eigenheim-Besitzer kennen das: Steigende Heizkosten. Sicher kann man über Dämmung einiges erreichen, aber bei Bestandsgebäuden – je nach Alter und Substanz – ist das wirtschaftlich und physisch riskant. Aus meiner langjährigen IT-Projekt-Erfahrung heraus bin ich also diversen „Experten“ (Energieberater, Dämmungs-Profis, Heizungs-Verkäufer,
Der Club
An die Freunde
Schiller war mit dem Freimaurer Christian Gottfried Körner befreundet, der von 1812 bis 1816 eine Gesamtausgabe von Schillers Werken herausgab. Als poetische Freundschaftserklärung an Körner schrieb Schiller im Sommer 1785 die „An die Freude“. Entgegen einer verbreiteten Meinung hat Schiller sein Gedicht nicht einer Dresdner Freimaurerloge zugedacht, sondern diese Widmung stammt von Johann Christian Müller, der es als Ode früh vertont hat. Schiller wohnte damals in einem umgebauten Bauernhaus in dem nahe Leipzig gelegenen Dorf Gohlis, einem heutigen Stadtteil Leipzigs, ab dem 13. September 1785 im Weinberghaus Körners in dem damaligen Dorf und heutigen Dresdener Stadtteil Loschwitz. Sein bis dahin sehr wechselhaftes Leben, vor allem durch Geldsorgen bedingt, änderte sich durch den mäzenatischen Freund Körner sehr. Inspiriert davon und von Dresden und den Waldschlösschenwiesen vollendete er „An die Freude“ im November 1785 und sandte sie am 29. November zum Druck für das zweite Heft der Thalia an den Buchhändler Georg Göschen in Leipzig. In dem Brief Schillers heißt es: „Das Gedicht an die Freude ist von Körnern sehr schön komponiert. Wenn Sie meinen, so können wir die Noten, welche nur eine ½ Seite betragen, dazu stechen lassen?“, die Schiller mit seinem Gedicht ing gedruckter Form am 13. und 23. Februar 1786 wieder zurückerhielt.
Zu beachten ist jedoch, dass Schiller Jahre später, nachdem die prärevolutionäre Euphorie der 1780er Jahre bei ihm verflogen war, “An die Freude“ keineswegs als Meisterwerk seinerseits bezeichnete. Vielmehr sei sie von der Realität abgewandt. In einem Brief an Körner schreibt Schiller am 21. Oktober 1800:
„Deine Neigung zu diesem Gedicht mag sich auf die Epoche seiner Entstehung gründen: Aber dies gibt ihm auch den einzigen Wert, den es hat, und auch nur für uns und nicht für die Welt, noch für die Dichtkunst.“ – Schiller: 21. Oktober 1800
Schon in ihrer Entstehungszeit war dieses Gedicht äußerst populär, wie bereits die vielfachen Umdichtungen in studentischen Stammbüchern beweisen. Noch heute wird das Lied von Studentenverbindungen vielfach gesungen, jedoch mit einer anderen Melodie.
Dass Ludwig van Beethoven sich ausgerechnet in einer Zeit der politischen Restauration (im Jahr 1824) entschloss, seine Neunte Symphonie mit einem Chorgesang mit Schillers Text enden zu lassen, bewertet Aribert Reimann folgendermaßen:
Nach all dem politischen Wirrwarr und den Schrecknissen der Zeit, die auch Beethoven selbst erlebt hat, ist dieses Werk am Ende ein Appell, eine Sehnsucht nach Verbrüderung, nach Freude und Jubel, nach der Utopie eines Weltfriedens, nach einer Welt ohne Kriege und Zerstörung.
Dieter Hildebrandt verweist darauf, dass der Hamburger Dichter Friedrich von Hagedorn schon 1744 – und damit vier Jahrzehnte vor Schiller – ein anderes Gedicht mit dem Titel An die Freude schuf. Reinhard Breymayer benennt pietistischen Einfluss besonders auf die Verse „Brüder – überm Sternenzelt / muß ein lieber Vater wohnen“ durch den Astronomen und Pfarrer Philipp Matthäus Hahn. Dessen Liebestheologie betonte die väterliche Liebe Gottes außerordentlich.
An die Freude
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligthum!
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.
Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle Weinend sich aus diesem Bund!
Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.
More coming soon. Keep in touch.